Brücken bauen zum Jubiläum

Text: Sarah Forrer
Seit 20 Jahren stärkt Pro Pallium Familien mit schwerkranken Kindern. Am Jubiläums-Symposium in Olten wird klar: Der Bedarf ist gross. Er steigt rasant – und es braucht neu konfigurierte Lösungen, verlässlichere Brücken zwischen den Angeboten und Entschädigungen für die Koordinationsleistungen der Familien.
«Wenn ich nur genug Unterstützung und Begleitung erhalte, würde vieles erträglicher.» Mit diesem Zitat der Pro Pallium-Gründerin Christiane von May aus den 1990ern begrüsst Ulrike Bohni die Teilnehmenden der Jubiläums-Veranstaltung in der Aula der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten. Die Regionalleiterin Zürich moderiert durch die vierstündige Veranstaltung mit zwei Inputreferaten und zwei grossen Rundtischgesprächen. Über 130 Interessierte kommen, einige schalten sich Online dazu.
Hier können Sie das gesamte Symposium nachschauen.
Erträglicher machen – darum geht es noch heute: «Wir können vieles nicht. Aber wir können entlasten. Augenblicke im Alltag schaffen», betont Ulrike Bohni. Geschäftsleiterin Veronika Hutter ergänzt in ihrer Rede: «Aus einer visionären Initiative der Stifterin ist ein einzigartiges Modell geworden, das auf Beziehung, Vertrauen und Wirkung baut. Unsere Freiwilligen begleiten Familien – sie hören zu, sind präsent, halten aus, geben Familien ein Stück Normalität zurück, während sie gleichzeitig dazu beitragen, dass Geschwisterkinder, Eltern und Angehörige Atem holen können.»
Freiwillige wirkungsvoll schulen
Beatrice Schlumberger zeigt daraufhin als Bildungsverantwortliche auf, wie Freiwillige auf ihre anspruchsvolle Aufgabe vorbereitet werden. Zwar haben sich die sechs Tage Präsenzschulung in Olten gut bewährt. Da sich aber zunehmend berufstätige Jüngere oder erfahrene Fachpersonen melden, wird das Angebot 2026 angepasst: vier Tage vor Ort, zwei online, daneben Online-Module zum Selbststudium. Beatrice Schlumberger dankt den Regionalleiterinnen, die Freiwillige sorgfältig passenden Familien zuordnen – nach Kompetenzen, Verfügbarkeit und persönlicher Chemie: «Damit Entlastung nicht zur Belastung wird.»
Blick auf Zahlen und Trends
Beat Sottas, Versorgungsforscher und Stiftungsrat, wirft einen Blick auf die Statistiken. «Wir haben einen Tsunami, der aufzieht», betont er. Auf der einen Seite steigen die Zahlen der schwerkranken Kinder rasant an; ein wichtiger Grund seien die vielen untergewichtigen Frühgeborenen und dazu gehörige Intensivmedizin. Auf der anderen Seite nehmen die Ressourcen ab: spezialisierte Institutionen haben keine Plätze mehr, die Budgets sind unter Druck, es fehlt an Fachpersonen für Abklärung, Therapie und Betreuung, komplexe Krankheitsverläufe und funktionelle Einschränkungen führen zu Burnouts bei Professionals. Für Beat Sottas ist klar: «Die Versorgungsnetze müssen anders konfiguriert und anders finanziert werden. Besonders die Pflege und Koordination durch die Familien braucht mehr Mittel. Und vor allem müssen wir Brücken zwischen den Angeboten schlagen!»
Erster runder Tisch …
Beim ersten Rundtischgespräch richtet die Moderatorin Elisabeth Jenny-Fuchs den Fokus auf die Bedürfnisse und Erfahrungen der Betroffenen. Jöri, der Sohn von Familie Niggli, kam schwerstbehindert auf die Welt. Die Ärzte gaben dem Buben kein Jahr, doch er wurde 34 Jahre alt. Für die Bauernfamilie eine enorme Herausforderung – nicht nur in ihrem Familiengefüge, sondern auch im Dorf. Sie erinnern sich an Nachbarn, welche die Strassenseite wechselten, um ja nicht mit ihnen reden zu müssen. «Es besteht ein gesellschaftliches Unvermögen, mit solchen Schicksalen umzugehen», betont Herrn Niggli. Später kam Jöri in die Stiftung Scalottas, welche sein zweites Zuhause wurde. Da nagten Frau Niggli Zweifel: «Bin ich eine schlechte Mutter, wenn ich mein Kind einfach so weggebe?» Sie hätte sich gerne mit Menschen in ähnlichen Situationen ausgetauscht. «Was mir gefehlt hat, war die Unterstützung für mich, für meine Sorgen und Ängste.»
Die soziale Ausgrenzung, das Bedürfnis nach Austausch mit Betroffenen in einer ähnlichen Situation. Das kennt auch Andri Christen. Seine Tochter ist mit fünf Jahren an einem Hirntumor gestorben. Er spricht noch einen weiteren wichtigen Punkt an: «Ich empfand das Thema Spitzenmedizin als sehr belastend». In der Onkologie bestimmten oft die Ärzte. Mit wenig Zeit. Wenig Geduld. Christen: «Abgrenzen. Stopp sagen. Zu spüren, was in dieser schweren Situation das Beste für das eigene Kind ist, ist in diesem Umfeld enorm schwer». Da brauchen Eltern Unterstützung. Alexandra Gächter, Regionalleiterin Ostschweiz, ordnet die komplexen Situationen und Herausforderungen ein.
… zweiter runder Tisch
Dagmar Domenig, Vizepräsidentin von Pro Pallium, leitet die die zweite Gesprächsrunde. Letizia von Laer (ZKSK Solothurn), Nicole Küng (IV Zürich), Hildegard Rapprich (Arkadis Olten), Cornelia Rumo (Youvita), Michael Ledergerber (Procap Zentralschweiz) und Beat Sottas gleichen den Handlungsbedarf aus Sicht unterschiedlicher Akteure ab und loten aus, welche Ansätze den Familien mehr Lebensqualität und Versorgungsgerechtigkeit sichern. Die Teilnehmenden sind sich einig, dass grosser Reformbedarf besteht. Letizia von Laer ortet ein Kernproblem darin, dass Fachpersonen gar nicht lernen, die Eltern als Experten einzubeziehen. Cornelia Rumo, Youvita-Geschäftsführerin, verweist auf die negativen Folgen der Angebots- und Leistungsauftragslogik. Es gehe aber nicht darum: «was bieten wir an, holt es euch. Sondern: Was ist der Bedarf der einzelnen Familien und wie können wir das flexibel und situationsgerecht adaptieren?»
Hildegard Rapprich von Arkadis Olten skizziert, wie ein bedarfsgerechter Ressourceneinsatz unter knapper werdenden Mitteln möglich ist. Nicole Küng zeigt, wie die vielfältigen Instrumente der IV optimal genutzt werden können. Beat Sottas setzt den Fokus auf mehr Lebensqualität zu Hause: «Die häusliche Situation muss sich reformieren. Da müssen wir anders zu denken beginnen!». Von der Politik sei kein grosser Ruck zu erwarten, sagt Michael Ledergeber von Procap Zentralschweiz. «Deshalb müssen wir uns interdisziplinär vernetzen – und über den Gartenhag schauen. Da braucht es Vernetzungen im Sozialraum und Projekte, die auch die Professionals verändern.» Er plädiert zudem für eine Finanzierung des Case Managements, das die Familien leisten.
Mit einer Synthese und Ausblick, grossem Dank und viel Applaus endet das Symposium – jedoch nicht der Austausch. Der mit vielen Höhepunkten und Informationen gespickte Nachmittag findet eine Fortsetzung, weil die meisten zum Apéro bleiben, um zu diskutieren, vernetzen und weiter Brücken zu bauen, ganz im Sinne des Jubiläums.









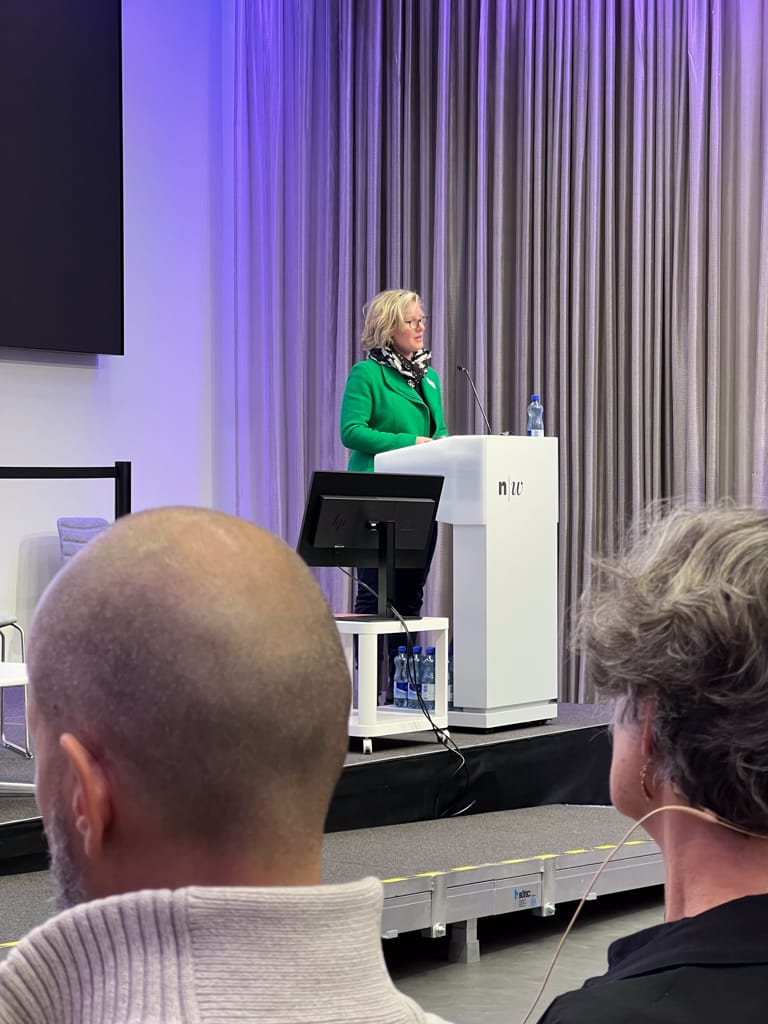




Weiterführende Informationen zum Symposium
Begrüssungsrede von Veronika Hutter
«Freiwillige wirkungsvoll schulen» von Beatrice Schlumberger
Trends & Umbrüche von Beat Sottas